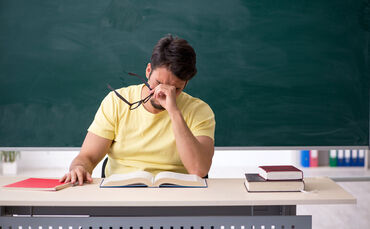Queer und geflüchtet: Wenn der deutsche Pass scheinbar keinen Schutz mehr bietet
Stuttgart. Bereits im Herbst 2023 fordert Friedrich Merz (CDU) Moldau, Georgien, Tunesien, Marokko, Algerien oder Indien als sichere Herkunftsländer einzuordnen, „damit wir sofort dorthin zurückführen können“, zitiert ihn die Tagesschau. Das soll nun Realität werden: Mit einem geplanten Gesetz sollen Herkunftsstaaten schneller als sicher eingestuft werden können. Doch wirklich sicher seien vor allem queere Personen in den meisten Ländern nicht, merkt unter anderem der LSVD+ Verband Queere Vielfalt an. Wie geht es Betroffenen mit dieser Debatte? Joulian ist selbst queer und 2015 nach Deutschland geflohen. Heute lebt sie in Stuttgart und fühlt sich als queere, syrische Frau auch in Deutschland oft nicht sicher.
Sichere Herkunftsländer: Das plant die Regierung aus CDU/CSU und SPD
Als sogenannte sichere Herkunftsländer oder Herkunftsstaaten gelten laut Bundesinnenministerium Länder, bei denen gesetzlich die Vermutung besteht, dass Menschen dort keine Verfolgung, Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe sowie Bedrohung infolge von willkürlicher Gewalt in bewaffneten Konflikten droht. Zu den sicheren Herkunftsstaaten zählen aktuell die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Serbien, sowie Ghana und Senegal.
Laut Koalitionsvertrag wollen CDU, CSU und SPD die sicheren Herkunftsländer um Algerien, Indien, Marokko und Tunesien erweitern. Nach einem Gesetzesentwurf sollen zukünftig sichere Herkunftsstaaten durch eine Rechtsverordnung der Bundesregierung eingestuft werden. Über die Einordnung muss dann weder im Bundestag oder im Bundesrat beraten noch diese dort beschlossen werden. Ziel sei es, so der Gesetzesentwurf, durch die „zügige Bestimmung von sicheren Herkunftsländern“, Asylverfahren zu beschleunigen, „so dass im Falle einer möglichen Ablehnung auch die Rückkehr schneller erfolgen kann“.
Kritik: Aus „begründeter Angst und Scham“ outen sich viele nicht
Der LSVD+ Verband Queere Vielfalt kritisiert das. „In den drei Maghrebstaaten (Anmerkung der Redaktion: Gemeint sind hiermit Algerien, Marokko und Tunesien) sind LSBTIQ∗ der Gefahr von mehrjährigen Haftstrafen, Folter durch Zwangsanaluntersuchungen und massiver Gewalt durch die Gesellschaft ausgesetzt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Folge, dass die Klagefrist auf eine Woche verkürzt und Asylsuchende auch während eines laufenden Verfahrens abgeschoben werden können, treffe vor allem queere Geflüchtete. Aus „begründeter Angst und Scham“, so der LSVD+, würden sich LSBTIQ∗ Geflüchtete bei der Anhörung nicht outen und ihren Asylgrund, queerfeindliche Verfolgung, oft gar nicht vortragen.
„Ich habe Asyl beantragt, weil ich Syrerin bin, nicht, weil ich homo bin“, sagt auch Joulian. 2015, mit 23 Jahren, kam sie gemeinsam mit ihrer Schwester über den Libanon, die Türkei, Griechenland und Österreich nach Deutschland. Mittlerweile lebt sie in Stuttgart, arbeitet in einem IT-Unternehmen. „Ich habe in Syrien Biologie studiert, aber IT war immer mein Traum“, sagt sie. Joulian ist mittelgroß, hat lange schwarze Haare. Sie trägt eine dunkle Hose, ein schwarzes T-Shirt, eine dünne Daunenjacke. Ihren Hals und ihr Handgelenk zieren dünne Goldketten – mit Maria und Sankt Charbel, einem Heiligen aus dem Libanon, wie sie selbst erklärt. Vor allem zu ihm fühle sie eine innige Beziehung – er beschütze sie.
Lesbisch in Syrien: „Ich konnte das natürlich niemandem erzählen“
In der achten Klasse habe Joulian das erste Mal gemerkt, dass sie sich zu Mädchen hingezogen fühlt. „Ich konnte das aber natürlich niemandem erzählen“, sagt sie. „Dann wirst du direkt geschlachtet oder kommst ins Gefängnis, bis sie dich totschlagen.“
Laut einem Bericht der Schweizer Flüchtlingshilfe aus dem Jahr 2020 verbietet Artikel 520 des syrischen Strafgesetzbuchs von 1949 gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen, auch wenn sie unter Erwachsenen einvernehmlich vorgenommen werden, und definiert sie als «Geschlechtsverkehr wider die Natur», der mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe sanktioniert wird. Queere Personen seien demnach außerdem von Gewalt und Misshandlungen – etwa durch die Familie, die Gesellschaft, Behörden, bewaffnete Gruppen, den IS oder der Jabhat Fatah Al-Sham – ausgesetzt.
Für Joulian war deshalb klar: Offen ansprechen werde sie ihre Sexualität gegenüber ihrer Familie nicht. „Wenn ich das ausspreche, wird die Enttäuschung bis zum Himmel gehen“, dachte sie. „Ich wollte meinen Eltern keine unruhigen Nächte bringen“. Ihr Cousin, „mein bester Freund“, hatte eine Vorahnung und sprach sie darauf an. Er selbst sei ihr gegenüber offen mit seiner Sexualität umgegangen, habe nicht versteckt, dass er schwul ist. Dass sie in einem queerfeindlichen Land eine Bezugsperson hatte, die ihre Gefühle versteht, sie akzeptiert und bei der sie sich sicher fühlt, sei für sie sehr wichtig gewesen. Mittlerweile sei sie auch bei ihren Eltern geoutet. „Ich habe sie nicht verloren. Sie akzeptieren mich und auch meine Partnerin“, sagt die 33-Jährige.
Queere Lebensrealität in Syrien: heimlich Beziehungen führen
Zur queeren Lebensrealität in Syrien gehörte für Joulian auch: Heimlich Beziehungen führen. „Natürlich muss man sich sicher sein, dass einen keiner beim Küssen sieht, aber das kriegt man hin“, sagt sie. „Vor den Eltern bist du dann eine enge Freundin und Textnachrichten löschst du, damit deine Schwestern oder andere sie nicht lesen können.“ Rückblickend fühle sich diese Situation belastend an und wäre heute für sie ein Grund, aus ihrem Heimatland zu fliehen. „Da geht es nicht um Krieg, oder darum, dass Leute einfach nach Deutschland kommen wollen, um Geld vom Sozialamt zu bekommen. Keiner will das“, sagt sie. Die Träume seien ganz anders „Sie wollen nur in Sicherheit leben“, sagt sie.
Joulian sieht es als Aufgabe von Staaten wie Deutschland an, queere Menschen zu schützen. „Ich kenne die Situation, in der sich viele befinden, ganz gut. Wir haben in Syrien, in einem arabischen und islamischen Land, keine Organisationen, die für queere Menschen da sind. Wie soll ich mich also dort schützen?“ Gleichzeitig hat sie aber auch die Sorge, dass manche diesen Asylgrund nur vorgeben könnten, ohne wirklich selbst betroffen zu sein. „Dann werden solche Leute vielleicht per Zufall akzeptiert und wirklich queere Personen bekommen eine Absage.“
Queerfeindlichkeit am Arbeitsplatz
Dass Queerness in Deutschland aber „überhaupt kein Thema ist“, wie sie es dachte, bevor sie selbst nach Deutschland gekommen ist, bezweifelt sie heute. Innerhalb der letzten zehn Jahre begegne ihr verstärkt Queerfeindlichkeit. „Bei der Arbeit hört man viele Kommentare wie ’Bist du jetzt schwul?’ oder ’Schwuchtel’“, sagt sie. „Aber was kannst du dagegen machen? Dich vor zwanzig Menschen stellen und sagen, dass sie das nicht sagen dürfen?“ Besonders traurig mache sie, dass auch junge Menschen queeren Personen verstärkt mit Hass begegnen.
Deutscher Pass biete keine Sicherheit mehr
Nach sechs Jahren in Deutschland beantragt Joulian den deutschen Pass. Für sie ein wichtiger Schritt. „Jetzt bin ich in diesem Land sicher, jetzt können sie mich nicht mehr so leicht wegschicken“, dachte sie sich. Doch dass ihr ein deutscher Pass auch in den nächsten Jahren noch Sicherheit geben wird, bezweifelt sie. Auch der aktuellen Regierung könne sie nicht vertrauen. Mit verstärkten Grenzkontrollen und Abschiebungen nach Afghanistan habe Bundeskanzler Friedrich Merz damit angefangen, „das zu tun, was er von Anfang an wollte: weniger Flüchtlinge, mehr Abschiebungen“, sagt sie. Vor allem auch seine Äußerungen über queere Menschen schockieren sie.
{element}Die letzte Regierung habe sie als menschlicher wahrgenommen, vor einer nächsten Regierung habe sie schon jetzt Angst. „Ich bin mir sicher, bei der nächsten Wahl werden noch mehr Menschen rechts wählen – das sehe ich an den Menschen auf der Straße“, sagt sie. „Wie soll ich dann hier leben? Ich bin hier sowieso nicht mehr willkommen, egal wie lange ich den Pass haben werde“, sagt sie. Die Meinungen werden immer härter und extremer, findet sie. Auch in Stuttgart habe sie an manchen Orten Angst, als syrische und lesbische Frau von muslimischen Männern Gewalt zu erfahren. Ob sie Hoffnung habe, dass sich an ihrer Lebensrealität etwas ändern könnte? „Nein ich habe keine Hoffnung, dass es besser wird“, sagt sie. „Ich hoffe, dass es so bleibt – und nicht noch schlimmer wird.“