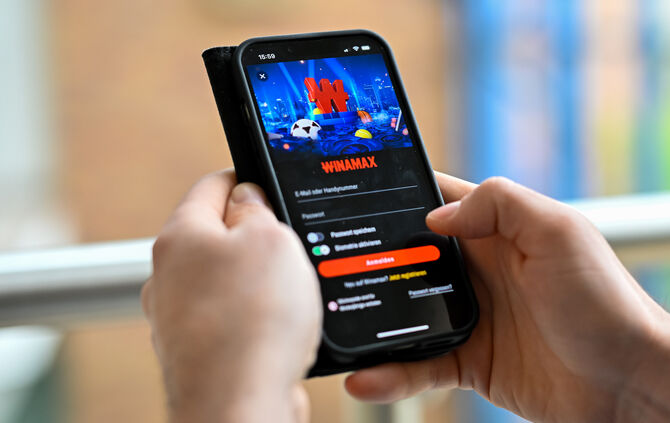Diskussionsrunde zu Sportwetten: Warum VfB-Sponsor Winamax ein Reizthema bleibt
Der Aufschrei in der Fangemeinde war gewaltig, als der VfB Stuttgart im vergangenen August den französischen Sportwetten-Anbieter Winamax als neuen Haupt- und Trikotsponsor vorgestellt hat. Mittlerweile ist es ruhig geworden um die Firma mit Hauptsitz in Paris. Die Branche kämpft derweil weiter gegen ihr schlechtes Image – kann das gelingen? Bei einer vom VfB-Fanprojekt initiierten Gesprächsrunde zeigte sich das Unternehmen nicht diskussionsbereit. Auch deshalb bleibt Winamax am Wasen ein Reizthema. Selbst wenn der VfB-Sponsor beileibe nicht der schlimmste Vertreter seiner Zunft zu sein scheint.
Warum der Winamax-Vertreter nicht zur Podiumsdiskussion gekommen ist
Zwar war ein Winamax-Repräsentant als Teilnehmer auf dem Podium angekündigt worden. Doch bei der Veranstaltung mit dem Titel „Wie fair können Sportwetten sein?“ im Jugendhaus „dasCANN“ blieb der Stuhl von Felix Boddenberg am Mittwochabend (24.04.) leer. Der Winamax-Marketingchef für Deutschland sagte seine Teilnahme kurzfristig ab. Es mache keinen Sinn, „wenn am Beispiel von Winamax eine ganze Branche an den Pranger gestellt“ werde, zitierte der Moderator des Abends, der Autor Bernd Sautter, aus der Absage. Zudem sah Boddenberg die Objektivität nicht gewahrt. Aufrufe an Fans auf X und Facebook, Fragen an Winamax zu stellen, „die nichts mit dem Thema der Veranstaltung zu tun haben“, seien ein klares Zeichen gewesen, „dass die Veranstaltung für andere Zwecke genutzt wird“.
Dem Austausch mit dem ehemaligen Spielsüchtigen und VfB-Fan Daniel Kessler, Florian Friederich vom Unternehmen Chargeback24, dem Präventionsfachmann Tilman Weinig von der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart und Johannes Singer von der Forschungsstelle Glücksspiel der Uni Hohenheim ging der französische Wettanbieter so aus dem Weg. Dabei hätte die Diskussion durchaus erhellend sein können. Und vermutlich auch kontrovers. Schließlich ist und bleibt das Geschäft mit den Sportwetten ein umstrittenes.

Das hat auch der VfB zu spüren bekommen, als er im vergangenen Sommer den Deal mit Winamax einging. Der bis 2026 laufende Vertrag soll den Schwaben laut Medienberichten 8,5 Millionen Euro pro Jahr einbringen. Sogar der Stuttgarter Investor Porsche hatte die Zusammenarbeit mit dem Online-Wettanbieter scharf kritisiert. „Was beim VfB rund um das Thema Glücksspiel in den letzten Monaten passiert ist, hat uns natürlich nicht gefallen“, ließ Lutz Meschke, Finanzvorstand beim Sportwagenbauer aus Zuffenhausen und mittlerweile VfB-Aufsichtsrat, damals wissen.
Eine erste Erkenntnis des Abends hätte Winamax hingegen gefallen. Im Gegensatz zu den anderen großen und lizenzierten Anbietern auf dem deutschen Markt wie beispielsweise Tipico halte sich der französische Anbieter wenigstens an die geltenden Regeln, so Florian Friederich, der mit seinem Unternehmen dafür kämpft, Verluste von Spielsüchtigen vor Gericht zurückzuholen.
Zumal die Vorgaben in Deutschland ohnehin zu diskutieren seien. So dürfen bei lizenzierten Anbietern pro Monat maximal 1000 Euro eingezahlt werden. „Das musst du auch erst einmal ausgeben können“, so Friederich. Er könne deshalb durchaus verstehen, „dass Winamax nicht mit der Masse in einen Topf geworfen werden will“. Seiner Ansicht nach wäre die Diskussion noch einmal eine Chance gewesen, „sich von genau dieser Masse abzugrenzen.“ So sieht es auch Tilman Weinig: „Man muss sich der Debatte stellen. Das hat dann nur Vorteile.“
Aber warum polarisiert das Thema überhaupt so sehr? Als App, im Web, ob Sportwetten oder virtuelle Spielautomaten: Möglichkeiten, online zu spielen, gibt es viele. Das ist gefährlich. „Online-Glücksspiele haben ein erhöhtes Suchtpotenzial, weil sie fast immer und überall verfügbar sind und zu jeder Tages- und Nachtzeit am Smartphone, Tablet oder PC gespielt werden können“, sagt eine Sprecherin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) unlängst auf dpa-Nachfrage. Durch die Anonymität im Netz und die virtuellen Geldeinsätze könnten sich „Verluste schnell unkontrolliert erhöhen und in eine Schuldenfalle führen.“
Wie VfB-Fan Daniel Kessler spielsüchtig wurde
Ein eindrückliches Beispiel dafür liefert der Stuttgarter Daniel Kessler, der selbst spielsüchtig war und deswegen letztlich sogar drei Jahre ins Gefängnis musste. „Es war ein Doppelleben“, berichtet er in bemerkenswerter Offenheit von seinen dunkelsten Tagen. Und dabei fing 2005 alles ganz harmlos an. „Es war eine ganz normale Wette im Büro mit Kollegen auf den nächsten Bundesliga-Spieltag – fünf Euro auf einem Fresszettel.“ Später verzockte er pro Tag 400 bis 500 Euro. Online, im Wettbüro und über Oddset. Die Sportwetten waren der Teil seines Alltags, den er vor Frau und Kindern geheim hielt. „Ich habe alles versucht, um das zu vertuschen.“
Warum er immer weitergezockt hat? „Der Gedanke war: Irgendwann kommt der große Jackpot und dann hole ich das alles wieder rein. Aber das funktioniert so halt nicht“, sagt Kessler. Stattdessen waren Erspartes und ein Erbe irgendwann komplett verbraucht. Jeder noch so kleine Gewinn wurde sofort wieder eingesetzt. Sein Verhalten habe er dabei nicht als Sucht wahrgenommen. Auch wenn ihm mittlerweile klar ist: „Wenn ein Süchtiger keine Drogen bekommt, wird er hibbelig. Bei mir waren es die gleichen Symptome, wenn ich nicht gewettet hatte.“
Im Januar 2020 landete er schließlich in der JVA Stammheim. Verurteilt zu einer Haftstrafe wegen Betrugs. Die Hehlerei hatte er angefangen, um seine Spielsucht zu finanzieren. Heute sagt er: „Die Rückfallgefahr ist immer da. Es ist eine anerkannte Suchterkrankung, die du nicht heilen kannst. Es gibt keine Medikamente.“ Seine Erlebnisse hat er im Buch „GameOver 23.01.2020“ verarbeitet.
So viele Spielsüchtige gibt es in Deutschland
Das Schicksal von Daniel Kessler ist kein Einzelfall. 35 Prozent der Bevölkerung in Deutschland hätten schon einmal gezockt, berichtet der Forscher Johannes Singer. Das sei der unproblematische Teil. Die viel besorgniserregendere Zahl: 2,3 Prozent der Bevölkerung haben laut den aktuellen Zahlen aus dem sogenannten „Glücksspielatlas“ des Bundesdrogenbeauftragten eine Glücksspielstörung. In absoluten Zahlen: etwa 1,3 Millionen Personen. Gerade jüngere Menschen seien betroffen. „Das ist alarmierend“, sagt der Wissenschaftler. Am gefährlichsten sei dabei das virtuelle Automaten-Spiel. Auf Platz zwei folgen jedoch bereits die Sportwetten.
Im Streit um unerlaubte Sportwetten hat der Bundesgerichtshof (BGH) erst vor wenigen Wochen den Spielern den Rücken gestärkt. Zahlreiche Menschen, die in früheren Jahren bei solchen Angeboten Verluste gemacht haben, können auf Rückerstattung verlorener Wetteinsätze hoffen. Zwar gibt es noch kein Urteil. Aus Hinweisen des BGH für eine im Mai geplante Verhandlung geht aber eine eindeutige Tendenz hervor - zugunsten der bis dato glücklosen Zocker. Fachleute wie Friederich rechnen mit einer noch größeren Klagewelle als es sie ohnehin schon gibt.
So arbeitet das Unternehmen Chargeback24 aus Stuttgart
Wie das Stuttgarter Start-up vorgeht? Grundsätzlich können 100 Prozent der Verluste bei Sportwettenanbietern ohne Lizenz eingeklagt werden – rückwirkend für mindestens drei Jahre. In den meisten Fällen kommt sogar ein Zeitraum von zehn Jahren infrage. Für Friederich und seine Kollegen sind die Klagen gegen illegale Wettanbieter also zum Geschäftsmodell geworden. Mit Chargeback24 gehen sie „pro bono“ in die Klagen. Heißt: Die Kunden müssen zunächst nichts dafür bezahlen. Sollten sie mit ihrer Klage scheitern, kommen auf die Kunden keinerlei Kosten zu. Bei einer erfolgreichen Klage berechnet das Unternehmen laut eigenen Angaben 35 Prozent der Rückerstattung als Vergütung.
Dass Tausende solcher Verfahren laufen, liegt vor allem daran, dass mehrere Firmen vor Jahren in einer rechtlich unklaren Lage Sportwetten angeboten hatten. Hier will Winamax als gutes Beispiel vorangehen. Seit 2021 sind die Franzosen als behördlich zugelassener Anbieter von Online-Sportwetten auf dem deutschen Markt tätig. Damit steht das Unternehmen unter der Aufsicht der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder. Zur Folge hat das strenge Auflagen - unter anderem in den Bereichen Spieler- und Jugendschutz.
Für viele, die dem Wettgeschäft in all seinen Formen ohnehin kritisch gegenüberstehen, bleibt es paradox. Winamax und die anderen lizenzierten Anbieter verschreiben sich der Sucht-Prävention. Und sind dabei selbst ein Teil des Problems. Wenn vielleicht auch nicht der größte. Das liegt nach wie vor im Schwarzmarkt, dem komplett unkontrollierten Bereich.
„Komplettversagen der Politik“: Was der Experte am Spielersperrsystem kritisiert
Strenge Regeln zu haben, ist also erst einmal gut. Sie müssen aber auch eingehalten werden. Und genau daran hapert es offensichtlich. Als Beispiel nennt Florian Friederich das Spielersperrsystem OASIS, das eigentlich die Einhaltung des Maximal-1000-Euro-pro-Monat-Limits kontrollieren soll. Diese Spielersperre soll eigentlich „ein spielformübergreifendes, bundesweites Instrument zum Schutz von Spielerinnen und Spielern und zur Bekämpfung der Glücksspielsucht“ darstellen, heißt es auf der Homepage des für die Sperrdatenbank verantwortlichen Regierungspräsidiums Darmstadt. Es war eine der wesentlichen Neuerungen im Glücksspielstaatsvertrag von 2021, sei aber eine Kontrolle, „die quasi nicht stattfindet“, so der Experte Friederich. Er spricht von einem „Komplettversagen der Politik“.
Mit Blick auf einen seiner Kunden, der beim Anbieter Tipico Tausende von Euro verzockt und regelmäßig die 1000-Euro-Grenze überschritten hat, meint Friederich: „Der Wetter hätte schon vor zwei Jahren gesperrt werden müssen!“ Passiert ist jedoch nichts. „Fremdsperren kommen quasi nicht vor“, bestätigt auch der Forscher Singer. Es sei fragwürdig, „was die Behörden da machen.“ Statt rigoroser Sperren werde viel zu häufig auf die Selbstverantwortung der Zocker gesetzt. „Das ist wie ein Barkeeper, der zum Alkoholiker sagt: Du meldest dich, wenn es zu viel ist“, so Singer.
Präventionsfachmann Tilman Weinig sieht das System hingegen nicht ganz so kritisch: „Immerhin ist das Instrumentarium da.“ Er hofft, dass die noch relativ junge Behörde „ins Rollen“ kommt. Weiter verweist Weinig auf die wichtige Unterscheidung zwischen lizenzierten und illegalen Anbieter. Er selbst schult regelmäßig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wettanbietern zum Thema Spielerschutz: „Bei einem lizenzierten Anbieter gibt es die Möglichkeit, dass die Spielsucht eines Zockers erkannt wird. Bei einem illegalen Anbieter ist er verloren.“ Für ihn sei zudem eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung vonnöten: „Welches Glückspiel wollen wir haben?“
Eine Kulturfrage: „Freiburg wirbt für Jobrad, der VfB halt für Winamax“
Derweil sieht Forscher Singer eine große Gefahr für die jüngere Generation. Gerade mit Blick auf die Aktivitäten der Anbieter auf Social Media. Dort werden gerne lustige Memes und nachrichtliche Inhalte geteilt. Es sei kein „aggressives Werben für die nächste Wette, sondern vielmehr soll das Wetten hier normalisiert werden“, so Singer. Deshalb sei das auch nicht als klassische Werbung erkennbar und gekennzeichnet, trage aber zur Normalisierung des Produkts bei. „Das ist gefährlich. Und diese Gefahr geht auch von den legalen Anbietern wie Winamax aus.“
Folglich steht auch der VfB Stuttgart, der auf seinem Brustring seit dieser Saison das Logo des Wettanbieters prangen hat, in der Verantwortung. „Es ist auch eine Kulturfrage“, sagt Tilman Weinig, „Freiburg wirbt für Jobrad, der VfB halt für Winamax.“
Anlaufstellen und Buch-Tipp:
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: https://www.check-dein-spiel.de/
- Gesundheitsamt Baden-Württemberg: https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/kompetenzzentren-netzwerke/gluecksspiel/
- Baden-Württembergische Landesverband für Prävention und Rehabilitation: https://www.bw-lv.de/
- EVA Stuttgart e.V.: https://www.eva-stuttgart.de/unsere-angebote/angebot/angebote-gluecksspiel
- GameOver 23.01.2020, das Buch von Daniel Kessler: https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1062690375